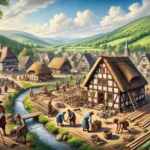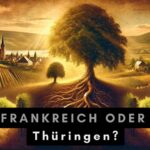Von der Pfalz nach Nordrhein-Westfalen
Pfalzdorf, ein heute zu Goch in Nordrhein-Westfalen gehörender Ortsteil, wurde Ende des 18. Jahrhunderts von Einwanderern aus der Pfalz, insbesondere aus dem Hunsrück, gegründet. Diese Auswanderungsbewegung war Teil einer größeren Welle deutscher Migrationen, die durch wirtschaftliche Not, politische Unsicherheit und religiöse Verfolgung in ihrer Heimat verursacht wurden.
Im Jahr 1741 erließ der preußische König Friedrich Wilhelm I. ein Einwanderungsedikt, das Menschen aus dem süddeutschen Raum, insbesondere aus der Pfalz, dazu ermutigte, sich in den wenig besiedelten Gebieten des Niederrheins niederzulassen. Dieses Edikt versprach den Siedlern Steuererleichterungen, Religionsfreiheit und Unterstützung beim Aufbau neuer Siedlungen. Die Siedler aus dem Hunsrück und der Pfalz brachten ihre kulturellen und landwirtschaftlichen Traditionen mit, was die Entwicklung der Region maßgeblich prägte. Sie errichteten Bauernhöfe, kultivierten das Land und trugen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Gebiets bei. Die neue Siedlung erhielt den Namen „Pfalzdorf“ in Anlehnung an die Herkunft der meisten Siedler.
Ein besonderer Sachverhalt verdeutlicht die Umstände der Gründung von Pfalzdorf. Im Herbst 1741 erhielt eine Gruppe kurpfälzischer Auswanderer, die ursprünglich nach Nordamerika auswandern wollte, von der Stadt Goch einen Teil der Gocher Heide als Siedlungsgebiet.
Diese Gruppe bestand aus reformierten und lutherischen Glaubensflüchtlingen. Die Auswanderer hatten geplant, über den Rhein nach Rotterdam zu reisen, um von dort nach Amerika überzusetzen. Allerdings konnten sie bei den niederländischen Grenzbehörden in Schenkenschanz keine Schiffspassage nach Nordamerika nachweisen. Aufgrund dieser fehlenden Dokumente wurde ihnen die Weiterreise auf dem Rhein verweigert. Da sie ihre Reise nicht fortsetzen konnten, nahmen sie das Angebot der Stadt Goch an und ließen sich auf der Gocher Heide nieder. Diese neue Siedlung, die später Pfalzdorf genannt wurde, entwickelte sich durch die harte Arbeit und Anpassungsfähigkeit der Siedler. Sie trugen zur landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region bei und brachten ihre kulturellen und religiösen Traditionen mit, was die lokale Kultur nachhaltig prägte.
Die Gründung von Pfalzdorf ist ein typisches Beispiel der friderizianischen Kolonisation, einer systematischen Einwanderungspolitik, die von König Friedrich II. von Preußen im 18. Jahrhundert initiiert wurde. Diese Politik zielte darauf ab, die wirtschaftliche und demografische Entwicklung der preußischen Gebiete durch die Ansiedlung von Ausländern zu fördern. Nach dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) war Preußen wirtschaftlich und demografisch geschwächt. Friedrich II. erkannte, dass eine Verstärkung der Bevölkerungsbasis und eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität notwendig waren, um die preußische Wirtschaft zu stabilisieren und zu stärken.
Friedrich II. erließ mehrere Edikte und Verordnungen, die Einwanderer anlocken sollten. Er bot Siedlern verschiedene Anreize, darunter Steuererleichterungen, zinslose Darlehen, Baumaterialien, Land und religiöse Freiheit. Diese Maßnahmen sollten die Ansiedlung besonders in den östlichen, weniger entwickelten Gebieten Preußens, wie Schlesien, Westpreußen und der Neumark, fördern. Die Siedler kamen aus verschiedenen Regionen, darunter die Pfalz, der Hunsrück, Österreich, die Schweiz, Frankreich (Hugenotten), und sogar aus den Niederlanden und anderen Teilen Europas. Die friderizianische Kolonisation umfasste auch Binnenmigration innerhalb der verschiedenen preußischen Provinzen.

Die friderizianische Kolonisation war weitgehend erfolgreich. Sie führte zur Gründung zahlreicher Dörfer und Städte, zur Urbarmachung von Brachland und zur Stärkung der Agrarwirtschaft. Die Ansiedler brachten neue landwirtschaftliche Techniken und Kenntnisse mit, die zur Produktivitätssteigerung beitrugen. Zudem förderte die Kolonisation die kulturelle und religiöse Vielfalt in Preußen. Insgesamt war die friderizianische Kolonisation eine bedeutende Maßnahme zur Förderung der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in Preußen, die das Land nachhaltig prägte und zur Grundlage seiner späteren wirtschaftlichen Stärke beitrug.
Die Geschichte der Pfälzer in Pfalzdorf ist somit ein Beispiel für die weitreichenden Auswirkungen der friderizianischen Kolonisation und zeigt, wie neue Gemeinschaften durch die Kombination von Traditionen und Anpassung an neue Umgebungen entstehen können.