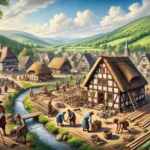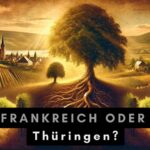Der Begriff „Ersatzreservist“ im Kontext des Ersten Weltkriegs bezeichnete eine spezielle Kategorie von Soldaten, die zur Verstärkung der regulären Truppen und Reserven vorgesehen waren.
Ersatzreservisten gehörten zur sogenannten Ersatzreserve, die neben der regulären Reserve und der Landwehr eine weitere Stufe in der militärischen Organisation darstellte.
Diese Kategorie umfasste Männer, die zwar wehrpflichtig waren, aber noch nicht aktiv im Heer oder in der regulären Reserve gedient hatten.
Häufig waren sie aus gesundheitlichen oder körperlichen Gründen zunächst als untauglich für den normalen Militärdienst eingestuft worden oder hatten eine eingeschränkte Dienstfähigkeit.
Ersatzreservisten wurden bei Bedarf eingezogen, insbesondere zur Auffüllung von Verlusten an der Front oder zur Verstärkung der Truppen.
Sie dienten häufig in Formationen der sogenannten Ersatztruppen, die für Ausbildung, Nachschub und die Auffrischung der kämpfenden Einheiten zuständig waren.
Viele Ersatzreservisten durchliefen zunächst eine Ausbildung in Ersatzbataillonen oder Ersatzregimentern im Hinterland, bevor sie an die Front geschickt wurden.
Sie kamen oft in späteren Kriegsphasen zum Einsatz, als die Verluste an der Front die regulären Einheiten stark dezimierten und der Bedarf an frischem Personal stieg.
Die Ersatzreserve war Teil des mehrstufigen Systems der deutschen Wehrpflicht, das im Rahmen der preußischen Heeresreform unter Karl von Clausewitz und Gerhard von Scharnhorst Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt worden war.
Dieses System blieb auch während des Ersten Weltkriegs in modifizierter Form bestehen.
Ersatzreservisten hatten oft weniger umfassende militärische Ausbildung als aktive Soldaten oder reguläre Reservisten, etwas, dass sie im Einsatz vor zusätzliche Herausforderungen stellte.
Besonders im späteren Verlauf des Krieges wurden auch Männer höheren Alters oder mit gesundheitlichen Einschränkungen eingezogen, da die Personalreserven des Kaiserreichs zunehmend erschöpft waren.