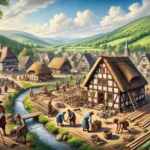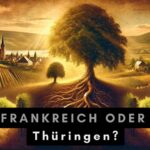Vertreibung der Pfälzer und der Ryswicker Frieden (1697)
Die Vertreibung der Pfälzer und die Verwüstungen ihrer Heimat durch die Franzosen zählen zu den erschütterndsten Ereignissen der europäischen Geschichte des 17. Jahrhunderts. Diese Tragödie war geprägt von religiösem Fanatismus, politischen Konflikten und den brutalen Auswirkungen eines Krieges, der die Region nachhaltig verwüstete.
Der Widerruf des Edikts von Nantes (1685) und die Angst der Pfälzer
Der Widerruf des Edikts von Nantes durch König Ludwig XIV. im Jahr 1685 entzog den französischen Protestanten (Hugenotten) die Religionsfreiheit, die ihnen seit 1598 garantiert war. Gewalt und Repression zwangen Hunderttausende Hugenotten zur Flucht. Diese Maßnahmen schürten auch in der Pfalz Ängste, insbesondere unter den protestantischen Einwohnern. Die Aussicht, ähnlichen Verfolgungen ausgesetzt zu sein, belastete die Bevölkerung zusätzlich, als Frankreich begann, Gebietsansprüche in der Region zu erheben.
Der Pfälzische Erbfolgekrieg und die Gewalt in Heidelberg und Mannheim
Im Jahr 1688 fielen französische Truppen unter Ludwig XIV. in die Pfalz ein. Der sogenannte Pfälzische Erbfolgekrieg führte zu unvorstellbaren Zerstörungen und Gewalt, die besonders in Städten wie Heidelberg und Mannheim verheerend waren.
Heidelberg: Die Stadt wurde von den französischen Truppen besetzt, geplündert und schließlich großteils niedergebrannt. Selbst das kurfürstliche Schloss, ein Symbol für Macht und Kultur der Region, wurde durch Minen gesprengt. Die Bevölkerung musste mit ansehen, wie historische Gebäude zerstört und wertvolle Güter geraubt wurden. Familien verloren nicht nur ihre Häuser, sondern oft auch Angehörige, die in den Kämpfen oder durch Gewalt starben.
Mannheim: Die Gewalt erreichte hier einen weiteren Höhepunkt. Der französische General Monclas hatte den Bürgern zunächst zugesichert, dass es weder Plünderungen noch Brandstiftungen geben würde. Doch ein königlicher Befehl änderte alles: Die gesamte Stadt sollte zerstört werden. Die Bürger wurden aufgefordert, ihre Häuser selbst niederzureißen, um die Baumaterialien zu retten. Als sie dies ablehnten, begannen Soldaten, die Stadt zu zerstören. Noch in derselben Nacht wurde Mannheim angezündet. Am nächsten Morgen bot sich ein Bild des Grauens: Menschen flohen mit den wenigen Habseligkeiten, die sie retten konnten, während die Neckarbrücke abgebrochen wurde, um den Flüchtlingen den Übergang zu erschweren. Kirchen, Festungen und ganze Stadtviertel wurden dem Erdboden gleichgemacht.
Diese Schilderungen sind nur Beispiele, die das Ausmaß der Gewalt andeuten. Die vollständige Beschreibung der Gräueltaten und Verwüstungen würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.
Die Flucht der Pfälzer und ihre Aufnahme in Brandenburg
Viele Pfälzer sahen keine andere Möglichkeit, als ihre Heimat zu verlassen. Ein Großteil der Flüchtlinge wurde in Brandenburg aufgenommen, wo Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, ihnen Land, Schutz und wirtschaftliche Privilegien bot. Diese Flüchtlinge brachten nicht nur Knowhow und Fertigkeiten mit, sondern trugen auch maßgeblich zur wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung ihrer neuen Heimat bei.
Der Ryswicker Frieden (1697) – Ein Ende des Krieges
Der Pfälzische Erbfolgekrieg endete schließlich mit dem Ryswicker Frieden. Dieser Vertrag regelte die Rückgabe vieler Gebiete, darunter auch Teile der Pfalz, an ihre rechtmäßigen Herrscher. Er sicherte den Protestanten ihre religiösen Rechte und legte den Rhein als natürliche Grenze zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich fest.

Die Zerstörungen in der Pfalz und die Vertreibung ihrer Bevölkerung zeugen von den Schrecken, die Krieg und religiöse Intoleranz mit sich bringen. Städte wie Heidelberg und Mannheim stehen als Mahnmale für die Grausamkeiten dieser Zeit. Gleichzeitig zeigt die Geschichte der Pfälzer Vertreibung, wie wirtschaftliche und kulturelle Verluste die betroffenen Regionen langfristig schwächen können, während aufnehmende Staaten wie Brandenburg durch den Zuzug profitierten. Der Ryswicker Frieden brachte zwar eine Atempause, doch die Wunden, die dieser Krieg hinterließ, heilten nur langsam.